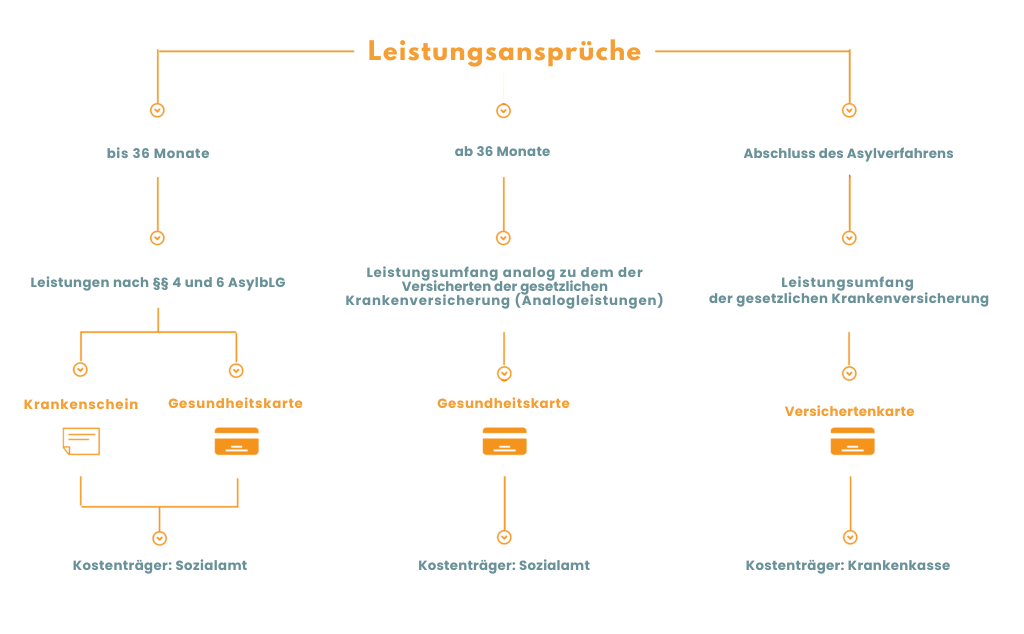Rund drei Viertel der in Deutschland lebenden Schutzsuchenden haben unterschiedliche Formen von Gewalt erfahren und sind oft mehrfach traumatisiert (Schröder et al., 2018). International konnte eine Prävalenzrate von rund 30 % für Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und depressive Erkrankungen bei Geflüchteten festgestellt werden (Steel et al., 2009).
Die Frage nach der Zahl der traumatisierten Geflüchteten in Deutschland ist eine der häufigsten Fragen an Akteur*innen der psychosozialen Versorgung für Geflüchtete. Ihre Beantwortung ist nicht einfach. Denn die Angaben zu Prävalenzen von Traumafolgestörungen bei Geflüchteten variieren deutlich in Abhängigkeit z. B. von der untersuchten Gruppe oder auch von den eingesetzten Erhebungsinstrumenten.
Um Aussagen darüber treffen zu können, wie viele Menschen von einer Krankheit betroffen sind, werden Prävalenzstudien durchgeführt. In den Studien zu Prävalenzen und damit zur Epidemiologie, d.h. zur Verbreitung von Krankheiten bei geflüchteten Personen, steht außerdem im Mittelpunkt, ob und wenn ja für wen das Risiko zu erkranken eher ab- oder eher zunimmt und welche Faktoren es beeinflussen.
Die Angaben zu Prävalenzen von Traumafolgestörungen bei Geflüchteten variieren deutlich in Abhängigkeit z.B. von der untersuchten Gruppe oder auch von den eingesetzten Erhebungsinstrumenten. International konnte eine Prävalenzrate von rund 30% für PTBS und depressive Erkrankungen bei Geflüchteten festgestellt werden (Steel et al., 2009). Es gibt nach wie vor nur wenige (repräsentative) Zahlen zu Prävalenzen von Traumafolgestörungen bei der zur Zeit in Deutschland lebenden Gruppe von Menschen mit Fluchterfahrung (Razum, Bunte, et al., 2016).
Eine nationale Studie der AOK (Schröder, 2018) zeigt auf, dass rund drei Viertel (74,7%) der in Deutschland lebenden Schutzsuchenden unterschiedliche Formen von Gewalt erfahren haben und oft mehrfach traumatisiert sind. Bei mehr als 40% der Befragten zeigten sich zudem Anzeichen depressiver Erkrankungen.
Bei einer Studie in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig mit 570 Personen zeigten 247 Personen (48,7%) ein positives Ergebnis beim Screening für mindestens eine der erfassten psychischen Erkrankungen. So wurden bei 31 % der Befragten Symptome einer somatoformen Störung, bei 22 % einer depressiven Erkrankung und bei 35 % einer PTBS festgestellt (Nesterko et al., 2019).
In einer Querschnittserhebung in Gemeinschaftsunterkünften in Baden-Württemberg im Rahmen des Forschungsprojekts RESPOND berichteten 19 % der Geflüchteten einen schlechten oder sehr schlechten Gesundheitszustand und 40 % chronische Erkrankungen. Etwa 45 % der Schutzsuchenden hatten ein positives Ergebnis in Screeningfragebögen zu Depression und Angst (Biddle, Menold, et al., 2019).
Weitere Informationen finden Sie unter:
Aktuelle Zahlen zur psychosozialen Versorgung durch die PSZ in den jährlichen Versorgungsberichten der BAfF: http://www.baff-zentren.org/veroeffentlichungen-der-baff/versorgungsberichte-der-baff/
Biddle, L., Menold, N., Bentner, M., Nöst, S., Jahn, R., Ziegler, S., & Bozorgmehr, K. (2019). Health monitoring among asylum seekers and refugees: A state-wide, cross-sectional, population-based study in Germany. Emerging Themes in Epidemiology, 16(1), 3. https://doi.org/10.1186/s12982-019-0085-2
Bozorgmehr, K., Mohsenpour, A., Saure, D., Stock, C., Loerbroks, A., Joos, S., & Schneider, C. (2016). Systematische Übersicht und „Mapping“ empirischer Studien des Gesundheitszustands und der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Deutschland (1990–2014). Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 59(5), 599–620.
Nesterko, Y., Jäckle, D., Friedrich, M., Holzapfel, L., & Glaesmer, H. (2019). Prevalence of post-traumatic stress disorder, depression and somatisation in recently arrived refugees in Germany: An epidemiological study. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e40. https://doi.org/10.1017/S2045796019000325
Razum, O., Bunte, A., Gilsdorf, A., Ziese, T., & Bozorgmehr, K. (2016). Gesundheitsversorgung von Geflüchteten: Zu gesicherten Daten kommen. Robert Koch-Institut, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung. https://doi.org/10.25646/2173
Schröder, H., Zok, K., & Faulbaum, F. (2018). Gesundheit von Geflüchteten in Deutschland – Ergebnisse einer Befragung von Schutzsuchenden aus Syrien, Irak und Afghanistan. WIdOmonitor, 1, 1–20.
Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C., Bryant, R. A., & van Ommeren, M. (2009). Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events With Mental Health Outcomes Among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 302(5), 537–549. https://doi.org/10.1001/jama.2009.1132